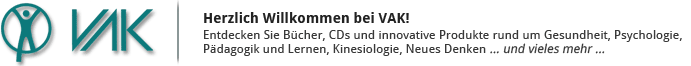VAK-News
Die unsichtbare Gefahr: Plastik in unserem Trinkwasser
18. Oktober 2017
Die Bilder von Plastikmüllbergen im Meer haben wir alle vor Augen. Weniger bewusst ist uns eine andere Gefahrenquelle: Auch in unserem Leitungswasser lassen sich inzwischen winzige Plastikfasern finden. Im Auftrag von OrbMedia, eines gemeinnützigen Journalisten-Netzwerks, untersuchten Wissenschaftler in mehr als 150 Ländern auf fünf Kontinenten Wasserproben und fanden heraus, dass weltweit ca. 83 Prozent des Trinkwassers mit Mikroplastik verseucht sind. In den USA enthielten mehr als 94 Prozent der Proben Mikroplastik, in Europa 72 Prozent. Auch in Mineralwässern, Bieren oder Honig konnten die winzigen Plastikteile bereits nachgewiesen werden.
Dieses Mikroplastik stammt aus Synthetikfasern unserer Kleidung, die beim Waschen in großer Zahl ins Abwasser gelangen, aus speziellen Pflegeprodukten mit Mikrokügelchen oder von Plastikverpackungen. Gängige Filter in Kläranlagen sind nicht fein genug, um die Kleinstteilchen zurückhalten zu können. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Plastikfasern und Partikeln auf den menschlichen Organismus sind heute noch nicht umfassend erforscht, im Tierreich sieht man aber bereits die Folgen der Plastikverschmutzung. So wurden unter anderem bei Meeresorganismen physiologische Störungen, erhöhte Sterberaten und Tumorbildungen festgestellt. Miesmuscheln lagern beispielsweise die kleinen Plastikpartikel in ihr Gewerbe ein, wo die Fremdkörper Entzündungen auslösen können. Dass ähnliche Effekte auch im menschlichen Körper auftreten, ist nicht unwahrscheinlich und gerade chronische Entzündungen stehen im Verdacht, das Auftreten von Krebserkrankungen zu fördern. Die Orb-Media-Studie wird von deutschen Experten allerdings mit Skepsis bewertet. Wie gefährlich Mikroplastik tatsächlich für Menschen ist, gehe aus ihr nicht zweifelsfrei hervor, so Ingrid Chorus, Trinkwasserexpertin des Umweltbundesamtes. Demnach ließe die Studie offen, in welcher Konzentration und Menge das Mikroplastik wirklich bedenklich wird.
Auch wenn an den Ergebnissen der Studie und der Herangehensweise Kritik geübt wird – ein wichtiger Denkanstoß für die Auseinandersetzung mit diesem immer stärker auftretenden Problem sind sie auf jeden Fall.
Der neuseeländische Umweltminister Nick Smith hat sich gerade ganz aktuell zu einer konsequenten Regelung entschieden: Ab dem Jahr 2018 müssen in Neuseeland sämtliche Pflegeprodukte ohne Mikroplastik-Bestandteile in den Verkauf kommen. Dieser drastische Schritt wurde notwendig, da sich trotz Selbstverpflichtungen der Unternehmen, den Einsatz von Plastik zu reduzieren, in den meisten Produkten noch immer Mikroplastik befindet. Neuseeland ist nach Kanada, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Schweden weltweit erst das fünfte Land, das ein entsprechendes Verbot erlässt.
Viele weitere Informationen sowie hilfreiche Tipps, wie Sie Plastik im Alltag vermeiden können, finden Sie in der VAK-Neuerscheinung "Plastik im Blut" hier im Shop.
18. Oktober
2017
Warum weckt Stress unsere Lust auf Süßes?
18. Oktober 2017
Wer kennt nicht den Begriff „Nervennahrung“ und hat sich in stressigen Situationen schon dabei ertappt, fast automatisch wieder und wieder zu Schokolade oder Gummibärchen zu greifen? Aber wieso verspüren wir eigentlich gerade bei Hektik, Ärger oder Prüfungsdruck Heißhunger auf Süßigkeiten und verlieren leicht die Kontrolle über unser Essverhalten?
Eine Erklärung für das Verlangen nach Süßem liegt in der Anpassungsleistung unseres Gehirns. In stressigen Situationen benötigt es mehr Energie, um seine Funktionsfähigkeit zu erhalten. Laut dem Diabetologen und Adipositas-Forscher Professor Achim Peters von der Universität Lübeck benötigt das Gehirn unter akutem Stress zwölf Prozent mehr Energie, die es am schnellsten über den Zucker erhält. Peters vertritt die „Selfish-Brain“-Theorie, die davon ausgeht, dass das Gehirn „egoistisch“ ist und in Stress- und Ausnahmesituationen rigoros seine Bedürfnisse nach Energiezufuhr durchsetzt, auch auf Kosten der Energieversorgung der anderen Organe. Stress setzt die beiden Hormone Adrenalin und Kortisol frei, die bewirken, dass unser Denkorgan mit mehr Glukose versorgt wird. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass Blutdruck, Puls und Muskelspannung steigen. Laut Professor Peters wird diese Anpassungsleistung des Körpers aber erst dann zu einem gesundheitlichen Problem, wenn wir ständig oder sehr lange unter starker Anspannung und Druck leben, ohne diese zwischendurch abzubauen. Dann kann ein Gewöhnungsprozess einsetzen. Die Stresshormone werden gedrosselt und dem Gehirn wird weniger Glukose zugeführt. Da es aber weiterhin vehement Nachschub verlangt, selbst wenn alle Speicher übervoll sind, bekommen wir Heißhunger auf Süßes und nehmen mehr Glukose zu uns, als wir tatsächlich benötigen. Die Folge ist Übergewicht. Eine beruhigende Nachricht für alle, die mit Übergewicht und Heißhungerattacken zu kämpfen haben: Diese haben wohl nichts mit Maßlosigkeit oder Charakterschwäche zu tun, sondern sind vor allem dem Selbsterhaltungstrieb des Gehirns geschuldet.
Bleibt die Frage, wie wir uns vor Heißhunger auf Süßes schützen können. Betroffene sollten versuchen, auf die Signale ihres Körpers zu achten, für sich herausfinden, welche Faktoren bei ihnen Stress und negative Emotionen auslösen und Nach spezifischen Lösungen suchen, die ihnen helfen, mit schwierigen Lebenssituationen besser umzugehen.
Übrigens kennt die Forschung auch geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit der Wirkung von Stress auf den Körper. Während Männer auf Druck eher mit aggressiv machenden Hormonen, wie zum Beispiel Noradrenalin, reagieren, schütten Frauen in den Nebennierenrinden vermehrt entzündungshemmende Corticoide aus. Da diese Hormone den Geschmack auf Süßes prägen, wählen Frauen eher Schokolade und Männer versuchen es mit Alkohol, der in Maßen als Noradrenalinhemmer fungiert.
18. Oktober
2017
Schwarzwurzeln: Das unterschätzte Herbstgemüse
18. Oktober 2017
Schwarzwurzeln finden in der Küche oft wenig Beachtung. Zu Unrecht, denn das Gemüse ist kalorienarm und nährstoffreich. Das typische Herbst- und Wintergemüse hat jetzt ab Oktober Saison. Schwarzwurzeln liefern viele Ballaststoffe, enthalten die Vitamine E, A und C sowie verschiedene B-Vitamine und punkten mit ihrem hohen Gehalt an Mineralstoffen wie zum Beispiel Magnesium – positiv für Herz und Kreislauf – Kalium, Kupfer und Mangan. Der hohe Gehalt an Phosphor, Eisen und Folsäure unterstützt die Gehirntätigkeit und beruhigt die Nerven. So werden Schwarzwurzeln auch noch zum echten Anti-Stress-Gemüse.
Zudem können Schwarzwurzeln bei der Entgiftung der Leber förderlich sein, die Bildung der roten Blutkörperchen anregen und sogar Osteoporose vorbeugen. Das Gemüse ist durch seinen hohen Inulingehalt außerdem auch für Diabetiker sehr bekömmlich.
Neben all diesen Pluspunkten hat das Gemüse allerdings einen kleinen Haken: In der Zubereitung ist es zugegebenermaßen etwas arbeitsaufwendig. Das Schälen der Schwarzwurzeln ist mühsam und zum Verarbeiten sind Gummihandschuhe empfehlenswert, da der austretende, weiße Milchsaft dunkle Flecken hinterlässt. Um zu verhindern, dass sich das Fruchtfleisch nach dem Schälen dunkel verfärbt, kann man es vor der Weiterverwendung kurz mit Essig- oder Zitronenwasser benetzen. Sowohl vom Aussehen als auch vom Geschmack ähnelt die Schwarzwurzel dem Spargel, daher der Beiname "Winterspargel" oder auch "Spargel des armen Mannes". Schwarzwurzeln passen gut in Eintöpfe, Aufläufe oder Suppen. Aber auch als Gemüsebeilage oder Salat sind sie gut geeignet.
Zwar ist die Verarbeitung des Gemüses etwas komplizierter, die Mühe lohnt sich aber allemal.
18. Oktober
2017